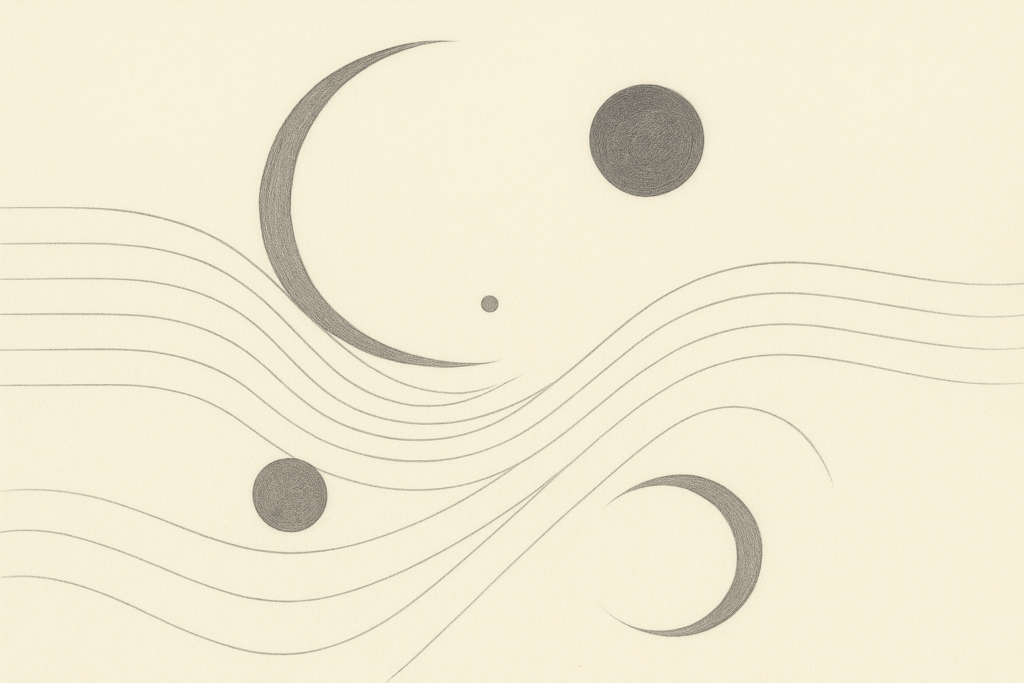Die erste Überlebensstrategie im NARM: Kontaktsicherheit, Distanz und Lebendigkeit
Abstract
Viele Menschen brauchen Kontakt – und erleben dabei gleichzeitig innere Unsicherheit, Anspannung oder Rückzug.
Aus NARM-Sicht sind diese Erfahrungen keine Störung, sondern verständliche Antworten auf frühe Kontakterfahrungen.
Dieser Artikel lädt dazu ein, die Kontakt-Strategie als erste Überlebensstrategie im NARM kennenzulernen, frühe Schutzmuster würdigend zu betrachten und neue Wahlmöglichkeiten im Kontakt zu entdecken.
Wenn Kontakt gebraucht wird – und sich nicht sicher anfühlt
Viele Menschen kennen dieses innere Spannungsfeld:
Wir brauchen Kontakt – Austausch, Gesehen-Werden, Dazugehörigkeit.
Und doch kann genau dieser Kontakt den Organismus verunsichern oder überfordern.
Manche ziehen sich in Gruppen innerlich zurück.
Andere spüren große Zurückhaltung, sich mitzuteilen – aus der Befürchtung heraus, nicht willkommen zu sein.
Wieder andere leben mit einer dauerhaften inneren Wachheit, als müsste jederzeit mit Rückzug oder Verlust gerechnet werden.
Wenn du dich darin wiedererkennst, bist du nicht allein.
Aus NARM-Sicht sind das typische Erfahrungen von Menschen, deren frühe Kontakterfahrungen nicht ausreichend sicher waren – nicht aus Fehlern heraus, sondern aus den Umständen ihres Aufwachsens.
Die Kontakt-Strategie im NARM
Im NARM sprechen wir von fünf Überlebensstrategien.
Die Kontakt-Strategie ist die erste – und sie beeinflusst alle weiteren.
Sie entsteht in den allerersten Lebensmonaten, lange bevor wir sprechen, denken oder wählen können. In dieser Zeit geht es um etwas sehr Grundlegendes:
Bin ich willkommen?
Gibt es Halt?
Bleibt jemand bei mir?
Wenn diese Erfahrung nicht verlässlich verfügbar ist, entwickelt das Nervensystem kreative Wege, um dennoch in Beziehung zu bleiben. So entsteht die Kontakt-Strategie – nicht als Defizit, sondern als intelligente Anpassung.
Sie bildet das Fundament dafür, wie wir später:
Kontakt erleben
Distanz regulieren
innere Lebendigkeit spüren
💡 Wenn dir beim Lesen etwas zu viel wird: Atme kurz aus, spüre deine Füße am Boden. Du kannst jederzeit pausieren.
Frühe Erfahrungen und Kontaktsicherheit
Unsere Beziehung zu Kontakt beginnt sehr früh.
Schon im Mutterleib nehmen wir Spannungen, Stress oder Entspannung wahr.
Nach der Geburt sind wir vollständig abhängig von wohlwollendem Kontakt:
Halt, Wärme, Schutz und Zuwendung sind lebensnotwendig.
Im Vergleich zu anderen Primaten sind wir Menschen besonders verletzlich.
Wir können uns nicht selbst regulieren oder festhalten – wir brauchen Beziehung.
Wenn diese Nähe nicht konstant oder ausreichend sicher verfügbar ist, orientiert sich das Nervensystem an Unsicherheit.
Das bedeutet nicht, dass „etwas falsch gelaufen“ ist – sondern dass der Organismus lernen musste, mit weniger Kontaktsicherheit umzugehen.
Vielleicht magst du kurz bemerken, was dein Körper gerade macht, während du das liest.
Wie ist dein Atem jetzt?
Zwei häufige Wege, Unsicherheit im Kontakt zu regulieren
Es gibt viele kreative Antworten auf frühe Unsicherheit. Zwei begegnen uns besonders häufig – ohne starre Kategorien zu sein.
1. Sicherheit über Denken und Analyse
Manche Menschen finden Halt im Verstand.
Denken, Strukturieren und Analysieren geben Orientierung – während das Fühlen in den Hintergrund tritt.
Oft zeigt sich das bei Menschen in stark analytischen Feldern.
Es entsteht eine innere Haltung wie:
„Wenn ich verstehe, bin ich sicher.“
Auch wenn das Denken Halt gibt, kann der Körper dabei angespannt bleiben.
Gefühle werden nicht unterdrückt – sie treten zurück, um Kontaktsicherheit zu wahren.
2. Sicherheit über Spiritualisierung
Andere Menschen finden Halt in spirituellen Konzepten oder Praktiken.
Spiritualität kann sehr unterstützend sein – manchmal dient sie jedoch auch dazu, Unsicherheit im direkten Kontakt zu umgehen.
Typische Muster sind:
Rückzug ins Transzendente statt in Beziehung
Überdecken von Schmerz durch Erklärungen
Idealisierung von Praxis oder Lehre
Auch hier kann nach außen Ruhe erscheinen, während der Organismus innerlich wach bleibt.
Würdigung dieser Schutzmuster
Diese Antworten waren intelligent, kreativ und notwendig.
Sie haben geholfen, da zu sein, Bindung nicht zu verlieren und Verletzlichkeit zu schützen.
Im NARM geht es nicht darum, diese Strategien loszuwerden.
Es geht darum, sie mit Mitgefühl zu würdigen – und zu prüfen, ob sie heute noch in gleicher Weise gebraucht werden.
👉 Ohne diese Kontakt-Strategien wären Bindung, Überleben und Entwicklung oft nicht möglich gewesen.
Kontaktstress im Erwachsenenleben
Frühe Muster wirken bis ins Erwachsenenleben hinein.
Sie können dazu führen, dass Kontakt innerlich als unsicher erlebt wird – selbst wenn im Außen Beziehung vorhanden ist.
Typische Zeichen von Kontaktstress:
innere Wachheit in Begegnungen
Rückzug trotz Kontaktbedürfnis
flacher oder angehaltener Atem
schnelle Verunsicherung bei Irritation
Vielleicht magst du einen Moment innehalten und spüren, ob es im Körper gerade einen kleinen Ort von Ruhe gibt – auch wenn er sehr unscheinbar ist.
Der Kernkonflikt der Kontakt-Strategie
Im Zentrum steht nicht Autonomie, sondern etwas Grundlegenderes:
Kontaktbedürfnis ↔ Kontaktsicherheit
Der Organismus sucht Verbindung – und rechnet gleichzeitig mit Unsicherheit, Rückzug oder Überforderung.
Diese Spannung ist kein Fehler.
Sie ist Ausdruck früher Schutzmuster, die heute in einem sicheren Rahmen neu erfahren werden dürfen.
Was im NARM stabilisiert
Stabilität entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch gegenwärtigen Halt:
Bodenkontakt
ein ruhiger Ausatem
ein Moment von Gesehen-Werden
Selbstmitgefühl statt innerer Härte
Oft reicht ein einzelner Moment von Sicherheit, um dem Organismus zu zeigen:
Jetzt ist etwas anderes möglich.
🌿 Kleine Einladung: Spüre deine Füße am Boden. Nimm wahr, wie der Atem kommt und geht.
Wege im NARM
NARM ist kein Reparaturansatz.
Es ist eine Einladung, neugierig zu erforschen, wie wir uns im Kontakt orientieren – innerlich und äußerlich.
Ein zentraler Schritt ist, die innere Strenge wahrzunehmen, die oft sehr früh entstanden ist – aus dem Versuch heraus, Kontaktsicherheit nicht zu verlieren.
Wenn wir lernen, dieser Strenge mit Freundlichkeit zu begegnen, entsteht Raum für neue Erfahrungen:
mehr innere Ruhe, mehr Lebendigkeit, mehr Kontaktfähigkeit.
Heilung geschieht dabei in Beziehung – durch neue, sichere Kontakterfahrungen, die dem Organismus erlauben, andere Wege zu finden als Rückzug oder Daueranspannung.
Fazit
Kontakt ist die Basis von Lebendigkeit.
Unsere frühen Erfahrungen prägen, wie sicher oder unsicher wir Kontakt erleben.
Wenn wir beginnen, diese Erfahrungen würdigend zu betrachten und neue Kontakterfahrungen zuzulassen, kann sich etwas wandeln – Schritt für Schritt, im eigenen Tempo.
Du bist nicht falsch.
Vielleicht braucht es nur ein paar freundlichere Schritte in Kontakt – mit dir selbst, mit anderen, mit dem Leben.
Hinweis:
Dieser Artikel ersetzt keine Therapie. Er dient der Information und als Einladung, den NARM-Ansatz kennenzulernen.
👉 Wenn du dich angesprochen fühlst, kannst du dich gerne an mich wenden.
Rafael Prentki
Heilpraktiker für Psychotherapie · NARM™ Practitioner